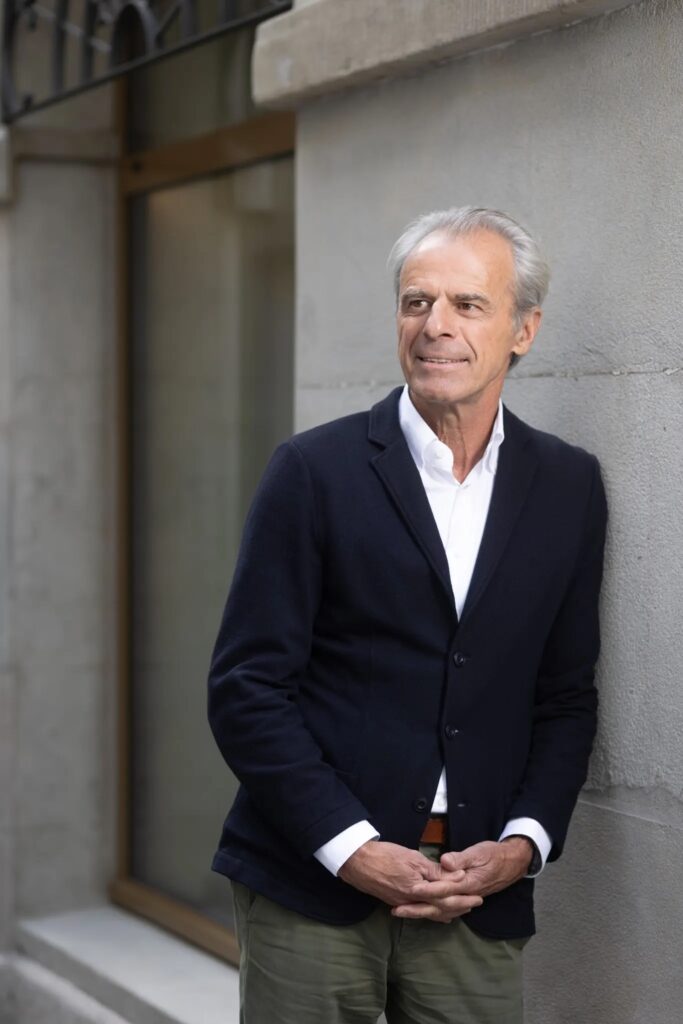Zeitmagazin – Alard von Kittlitz
Der russische Multimillionär Vitaly Malkin kann sich kaufen, was immer er will – und macht das auch. Er will der Welt aber einmal mehr hinterlassen als nur Geld. Ein seltener Einblick in das Leben eines Superreichen. Von Alard von Kittlitz
Einmal, gegen Ende unserer gemeinsamen Reise schon, in Monaco, will Vitaly Malkin mir in seiner Wohnung plötzlich die sogenannte Icaros-Maschine vorführen. Es handelt sich um ein massives, weiß lackiertes Fitness-Gerät, Malkins Diener muss das Ding im Heimkino aufbauen, der Herr demonstriert dann selbst, wie es funktioniert. Er balanciert bäuchlings auf dieser Maschine, einer Art wackeligen Plattform auf einem Gestell, und setzt sich eine 3-D-Brille auf die Augen. Es beginnt vor seinen Augen dann offenbar eine Simulation, Malkin steuert darin ein Fluggerät, indem er auf der Plattform vorsichtig sein Gewicht verlagert. Neigt er sich nach links, macht der Flieger eine Linkskurve, neigt er sich nach hinten, steigt er auf, und so weiter.
Die Sache scheint mordsanstrengend zu sein. Schon nach wenigen Sekunden auf seiner grotesken Maschine ächzt und flucht Malkin zwischen zusammengebissenen Zähnen auf Russisch. Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn, bald zittert der ganze Körper. Er keucht. Neben ihm steht sein Diener und betrachtet die Szene mit unverhohlener Bewunderung.
So ist das also. Da stehe ich in dieser immensen, vergoldeten Glitzer-Wohnung, hoch über den Dächern von Monaco und mit Blick auf das blaue Mittelmeer. Vor mir knechtet sich der Protagonist meiner Geschichte auf einer 9.000 Euro teuren, seltsamen Foltermaschine, ohne dass ich genau verstehe, warum, aber wahrscheinlich, um mir ein Vergnügen zu bereiten.
Vitaly Malkin, 66 Jahre alt, ist ein sehr, sehr reicher Herr aus Russland. Ganz früher einmal war er Physiker, dann brach die Sowjetunion zusammen, da wurde er Bankier und verdiente in wenigen Jahren Hunderte von Dollarmillionen. Später, 2004, ernannte man Malkin zum Senator der Republik Burjatien, fast zehn Jahre blieb er das, bevor er 2013 Privatmann und endlich, vor Kurzem, Buchautor wurde. Malkins erstes Buch heißt Gefährliche Illusionen, ist gleichzeitig in fünf Sprachen erschienen und eine Kampfschrift gegen Religion. Der Autor wünscht sich, dass über das Buch gesprochen und berichtet wird, deshalb erklärt er sich dazu bereit, dass ich ihn für ein paar Tage in seiner Welt besuchen darf – in einem Leben und einem sozialen Umfeld, das normalerweise hinter hohen Zäunen, jenseits der Vorstellung der weniger betuchten Menschheit stattfindet. Unterwegs mit und nah dran also an einem philosophierenden russischen Superreichen in Moskau und Monaco, schauen, wie so ein Mensch lebt und tickt, Einblick in einen anderen Kosmos, das ist die Abmachung.
Landung am frühen Abend am Moskauer Flughafen Scheremetjewo. In der belanglosen Ankunftshalle kurzes Warten auf Robert Eberhardt, Malkins deutschen Verleger, der ein bisschen später landet und auf der gesamten Reise dabei sein wird. Eberhardt, ein Thüringer, erscheint mit Hornbrille, Blazer und heller Hose, ordentlich, adrett, ein sehr ehrgeiziger, noch ganz junger Mann, keine 30. Sein Wolff-Verlag publiziert eher Kulturgeschichtliches für Liebhaber. Malkin ist ein Ausnahmeautor, für die Veröffentlichung seines Buches hat der Verleger Geld vom Autor bekommen, nicht umgekehrt.
Wir werden abgeholt, da steht ein breitschultriger, kurz geschorener Kerl mit wenig Mimik, Typ Ex-Militär, und hält ein Schild in der Hand: „Robert Ederhardt“. Unser Fahrer. Auf dem 60-sekündigen Weg zwischen Flughalle und Parkhaus schafft er es, eine ganze Zigarette runterzurauchen.
In einem schwarzen Ford geht es nun zum Landhaus von Herrn Malkin. Die Fahrt durch das Peripherie-Moskau dauert ewig, vier- bis fünfspurig schleppt sich der Verkehr über die Autobahn. Der Himmel ist groß und grau, draußen ziehen riesige Hochhaussiedlungen vorbei und fantastisch glitzernde Malls, dazwischen bemerkenswert viele Autohäuser.
Irgendwann doch die Ausfahrt, plötzlich sind wir in der Natur, der Fahrer drückt aufs Gas, wir rauschen durch hübsche Birkenwälder und über neblige Wiesen, auf denen riesige, gespenstisch weiße Blumen wachsen. Endlich vor uns eine Schranke mit Wärterhäuschen, ein schläfriger Typ in Flecktarn lässt uns durch, wir fahren nun durch eine gepflegte Parkwelt mit grünem Rasen, schwarzem Asphalt und Häuserdächern hinter gestutzten Hecken. Es handelt sich um eine Gated Community, in der, wie wir später erfahren, hauptsächlich sehr hohe Beamte und verdientes Personal der Ära Jelzin leben.
Wir gelangen an ein Tor, getragen von zwei Obelisken aus Basalt, das Tor öffnet sich, vor uns, auf einem sanft sich aufschwingenden Hügel liegend, ein großes Herrenhaus des 19. Jahrhunderts mit Blick über Teich und Wälder. Am Eingangsportal wartet zwischen ein paar Dienern bereits der Hausherr, Vitaly Malkin. Ein eher kleiner Mann, Halbglatze, in Poloshirt und Khakis, sein Englisch mit schwerem russischem Akzent. Handschlag, er mustert mich kurz, dann, gleich als Erstes, kleine Führung über die Latifundie. Malkin redet, wir folgen, er weist auf eine Messingplakette hin, auf der zu lesen steht, dass Lenin dieses Haus besuchte und seine Witwe darin lebte. Es geht außen über eine sehr große, schöne Veranda in ein neu gebautes Pool-Haus, der Pool still und unbewegt. Malkin ist, erfahren wir, bloß Mieter hier, sein Eigenheim nebenan wird derzeit renoviert. Gerne, sagt Malkin, hätte er uns dort die Tennishalle gezeigt, 16 Meter hoch sei die Decke, eine Anlage, in der Profimatches gespielt werden könnten. Er selbst spiele allerdings kein Tennis.
Das Mietshaus sieht von innen so aus wie alle Häuser, die ich von Malkin noch sehen werde, glitzernd, glänzend, spiegelnd, poliert; golden, silbern, marmorn, pastellig; ausladend, barock. Es liegt Spielzeug für Erwachsene herum, ein Segway, eine Drohne, zu sehen ist auch ein aus Monaco mit angereistes, teures Tier, eine haarlose Pharaonenkatze. Malkin zeigt uns das Untergeschoss, ab und an begegnet man einer Dienstkraft, ansonsten wirkt das Haus leblos. Vor der geschwungenen Treppe ins Obergeschoss allerdings stapeln sich kleine und große Sportschuhe, Nike, Gucci und Balenciaga, hier machen wir halt. Das obere Stockwerk ist das Reich der jungen Freundin von Malkin und der drei gemeinsamen Kinder im Alter von eins, zwei und fünf. Dieser Teil wird nicht gezeigt.
Es gibt Abendessen. Im Speisezimmer setzt sich Malkin an den Kopf des riesigen Esstisches, die Köchin fährt auf, dem Verleger und mir wird ein Dinner gereicht von kaltem, eingelegtem Aal in verschiedenen Ausführungen, dazu Salat, Schwarzbrot, Obst, eine Käseplatte, dies sind die Vorspeisen. Malkin selbst rührt wenig an, rät aber eifrig zum Kosten von diesem und jenem. Es folgen Fasan, Apfelstrudel, Kaffee und Konfekt. Zu trinken gibt es Wasser und einen schweren Saint-Émilion.
Vorsichtige erste Unterhaltung über Moskau, Vergangenheit und Gegenwart, Malkin redet allein, wie ein Senator, gewohnt, dass die Leute zuhören. Die Stadt, erklärt er, sei in den Neunzigerjahren, als er ein großer Mann wurde und der Systemwandel stattfand, viel wilder gewesen, um drei Uhr morgens habe man eine Harley-Davidson kaufen können, wenn einem der Sinn danach gestanden habe, und ein paar der besten Restaurants hätten 24 Stunden am Tag aufgehabt, sieben Tage die Woche, Foie Gras und Schampus zum Katerfrühstück. Er selbst habe leider nicht viel mitgekriegt von dem Exzess und der Feierei, er habe ja immer nur geschuftet, nach der Arbeit habe er bei den Partys mal zehn Minuten hereingeschaut in Anzug und Schlips, dann, sagt er, sei er immer nach Hause, ins Bett.
Wir wohnen in Malkins eigenem Haus, in dem, das nebenan liegt und gerade renoviert wird, es sind eigentlich mehrere Häuser, seltsame, glatte Kästen wie aus Lego, durch ein Netzwerk unterirdischer Tunnel verbunden, damit man im Winter nicht immer die Jacke anziehen muss auf dem Weg von A nach B. Im Trakt, in dem wir wohnen, finden gerade keine Bauarbeiten statt. Zwei Haushälterinnen in schwarzem Kleid und weißer Schürze führen uns durch polierte Flure auf unsere Zimmer, frisch geschnittenes Obst steht auf den Tischen, staubige Bildbände in den Regalen, scheußliche, billige Kunst hängt an den Wänden. Das Haus ist riesig und tot.
Wir werden zum Frühstück abgeholt in einem anderen Auto, einem Lexus-SUV, und zu Malkin gefahren. An der Tür begegnen wir Nastya, Malkins Assistentin, mit der er an dem Buch gearbeitet hat. Nastya ist keine 30, verheiratet mit einem Spitzenkoch, hat in Paris Philosophie studiert an einer Grande École. Sie bringt uns ins Pool-Haus, Malkin zieht dort gerade seine Bahnen, wir dürfen zuschauen, bevor er dampfend dem Becken entsteigt, die Schwimmbrille ablegt, Handschlag, dann verschwindet er im Bademantel, um wenig später in einem grellweißen Lacoste-Trainingsanzug wieder am Frühstückstisch zu erscheinen. Es gibt Blinis, Porridge, Brot, Pfannkuchen, Obst, Kompott, Aufschnitt.
Am Tisch sitzen außer Eberhardt, Nastya und mir heute noch zwei weitere junge Frauen. Eine, die in diesem Artikel nicht namentlich erwähnt werden mag, sie ist aber genau wie Nastya eine in Paris studierende russische Spitzenakademikerin und ebenfalls angestellt als Assistentin für Malkins Schreibarbeit. Außerdem zugegen: die russische Verlegerin aus St. Petersburg. Man will die bevorstehende Veröffentlichung der russischen Ausgabe von Gefährliche Illusionen besprechen. Malkin will mit den Frauen die bisherigen Rezensionen in Zeitungen und Internet diskutieren und verstehen, was am Buch noch verbesserungswürdig ist, bevor er es in seiner Heimat in die Läden bringt.
So macht er das, an Büchern arbeiten. Das geht generalstabsmäßig, er hat eine Idee, delegiert Recherchearbeiten, lässt sich zu Fragen, die ihn beschäftigen, Lektürelisten zusammenstellen, diskutiert seine Gedanken und Ergebnisse mit den klugen Sparringspartnerinnen, schreibt auf, diskutiert abermals. Er arbeite grundsätzlich lieber mit Frauen, sagt Malkin, die seien schlauer, direkter als Männer, stärker auch. In Malkins Reden über Frauen schwingt stets ein Hauch von Gönnerhaftigkeit mit, er hat, scheint mir, kein sehr zeitgenössisches Frauenbild, beziehungsweise er glaubt halt, dass Männer so und Frauen so seien, dass die Natur da viel schwerer wiege als die Kultur. Er findet, es werde gegenwärtig zu viel rumdiskutiert über Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe und so weiter, früher, als weniger Aufhebens gemacht wurde, sei manches besser gewesen. Vielleicht wenig überraschende Ansichten eines älteren, reichen Mannes.
Wie reich ist er eigentlich? Gute Frage, sagt Malkin. Das, was auf Wikipedia stehe, geteilt durch zwei. Das würde bedeuten: rund 425 Millionen Dollar. Allerdings, sagt Malkin, sei das nicht so leicht zu quantifizieren. Was ist sein Immobilienbesitz zum Beispiel wert, seine Privatwohnungen in New York, Paris, Moskau, Tel Aviv, Wien? Wie viel das Chalet in Courchevel? Ein andermal sagt er, mehr als 20 Millionen Dollar im Jahr brauche kein Mensch, einmal im Jahr habe man Geburtstag, da lade man Sting oder Madonna für die Musik ein, sonst seien da doch keine großen Ausgaben.
1952 wurde Malkin in eine jüdische Familie geboren, aus der Ukraine stammend, aufgewachsen ist er östlich des Urals. Er ist Einzelkind. Der Vater, Ingenieur, ist überzeugter Kommunist. Vitaly fängt schon als Kind an, das System zu hinterfragen, später, als Student, hasst er es offen, verachtet die Sowjetunion, verehrt Amerika, Neil Armstrong statt Juri Gagarin, auch eher Martin Luther King als Alexander Solschenizyn. Die Unfreiheit des Denkens, die Verlogenheit der Propaganda in der Sowjetunion, all das findet er unerträglich. Als Junge liest er wie verrückt, seine Mutter hat eine umfassende Bibliothek der europäischen Literatur, die arbeitet er durch.
Wo diese Bibliothek eigentlich sei, fragt Malkin sich dann auf einmal laut. Später werde ich denken, dass Malkin irgendwie eigentlich nichts besitzt. Alles um ihn herum gehört und gehorcht ihm zwar, aber nichts hat etwas Persönliches, Bewohntes, Gelebtes, nichts scheint alt, geliebt, geschätzt, er wirkt wie ein steter Gast in seinem eigenen Leben.
Als Jugendlicher hört Malkin auf zu lesen und widmet sich den Zahlen, er kommt auf eine Begabtenschule für Mathematik und Physik, studiert, promoviert über die Dichte von Laserstrahlen, wird Dozent und Forscher. Wenn man Malkin fragt, was er vermisst aus dieser Zeit, dann sagt er: Nichts, und dann fällt ihm ein: Doch, wir hatten ja nichts außer Reden, Trinken und Vögeln, das war schön, man war die ganze Zeit im Gespräch und schnell im Bett miteinander, alles war einfacher.
1991 löst sich die Sowjetunion auf, aus dem einfachen Bürger Vitaly Malkin wird in wenigen Jahren der Bankier: 12.000 Angestellte, Privatjets, Assistenten, Meetings, Macht.
Er will über diesen Aufstieg nicht so viel erzählen. Nichts sei bemerkenswert gewesen, sagt er, das Spielfeld habe weit und offen vor ihm gelegen, ohne große Konkurrenz, ohne große Regularien. Er habe damals nicht reflektiert, was da so schnell aus ihm wurde, er habe einfach gearbeitet. Geld verdiente er zunächst mit dem Import von Computerteilen und Tastentelefonen, alle, behauptet Malkin, hätten das damals gemacht, was natürlich nicht stimmt. Er habe einen tollen Partner gehabt, sagt Malkin, der Mann hieß Bidsina Iwanischwili, später wurde der Premierminister von Georgien. Mit Iwanischwili gründete Malkin auch Rossiysky Kredit. Diese Bank ist inzwischen pleite und nicht so gut beleumundet, aber Malkin und Iwanischwili wurden reich mit ihr. Malkin sagt, vor allem durch eine Privatisierung in der Eisenerz-Industrie.
Es war, so viel sagt Malkin immerhin, der Wilde Westen. Es gab viele Prozesse gegen Malkin, er hat sie alle gewonnen, stets seine Unschuld beweisen können. Wenn man ihn nach den alten Zeiten fragt, erklärt er sie kurz und ungeduldig, als seien die Fragen naiv. 2004 steigt Malkin aus dem Bankgeschäft aus und wird Senator von Burjatien, einer Republik der Russischen Föderation tief im Südosten des Landes, an der Grenze zur Mongolei. Er wisse nicht mehr genau, warum, sagt er, Langeweile vielleicht oder genug Geld auf dem Konto. Als Senator ist er nicht oft in Burjatien, wird aber zweimal wiedergewählt. Er sei stolz auf das, was er dort geleistet habe, sagt Malkin, viele Milliarden habe er nach Burjatien geholt, Straßen, Theater, Stadien gebaut dort, am Rand des Reiches. Das Leben als Politiker sei spannend gewesen. Als 2013 ein Gesetz beschlossen wird, nach dem alle Senatoren ihren gesamten Auslandsbesitz offenlegen und im Zweifelsfalle verkaufen müssen, tritt Malkin wie viele Kollegen von seinem Amt zurück. Er ist seither Privatmann.
Wann wir denn über sein Buch reden würden, will Malkin nun wissen. Er wirkt ein bisschen genervt. Eberhardt und ich werden fortgeschickt, Malkin will arbeiten. Der Verleger und ich sollen so lange eine Rudertour auf einem kleinen Fluss in der Nähe machen. Wir werden nicht gefragt, ob wir das wollen. Noch mal ein neuer Chauffeur fährt uns zu einer Landestelle, davor ein gepflegtes Fußballfeld, die Kinder der Nachbarschaft kicken in Russlandtrikots, die Nannies stehen drum herum, schieben Kinderwagen, schauen in ihre Handys. Eberhardt und ich rudern, es ist schwül, wir sehen die Birkenwälder, magere Jungs, die von Stegen ins Wasser springen, die Ufer gehen steil nach oben, man hat uns hergefahren, abgesetzt, losgebunden, eigentlich wissen wir überhaupt nicht, wo wir sind, irgendwo bei Moskau ja wohl.
Zum Lunch, Bœuf Stroganoff, dürfen wir zurück. Kurz erleben wir am Tisch Malkins Freundin. Sie sieht aus wie eine Elfe, zart, porzellanen, alterslos, sie ist die Mutter von den drei kleinen Kindern und isst vorsichtig und langsam Salat und ein wenig Fleisch. Sie spricht während des Mittagessens kaum ein Wort mit Malkin, wirft ihm höchstens spöttische Blicke zu. 15 Minuten am Tag, sagt Malkin, verbringe er mit ihr in der Regel, am Abend, wenn der Tag bewältigt sei, stimmt’s, fragt er sie, aber die Freundin ist gerade auf Instagram unterwegs und antwortet nicht. Von seiner Frau, mit der er drei erwachsene Söhne hat, lässt Malkin sich gerade scheiden.
Reden wir nun also, hier am Tisch und dann auf der Fahrt in die Stadt rein, Malkin hat dort einen Arzttermin, über sein Buch. Es finden sich darin keine sonderlich bemerkenswerten Gedanken. Malkin listet all die Gründe gegen Religion auf, die vor ihm schon anderen eingefallen und von anderen aufgeschrieben worden sind. Interessant ist am ehesten noch das letzte Kapitel, Malkin schreibt darin über Masturbation, dieses schlichte, stets verfügbare Gratis-Vergnügen des menschlichen Körpers, und erzählt dann, wie aus der unschuldigen Sache eine Sünde, etwas Schlechtes, Verbotenes, etwas Schambehaftetes wurde. Religion ist für ihn etwas, das den Menschen deformiert, verstümmelt, entstellt, und es ist Malkins Wunsch, dass der Mensch sich selbst doch bitte schön liebevoller, einsichtsvoller und nachsichtiger behandeln sollte, als manches Dogma es ihm nahelegt. Er wünscht sich den Menschen frei von Schuldgefühlen, das Leben soll genossen werden.
Gefährliche Illusionen ist dabei nur das erste Buch von vielen, die Malkin noch schreiben will. Eins über das Geschlechterverhältnis soll noch kommen, eines über Monogamie, das nächste, an dem arbeitet er bereits, beschäftigt sich mit der Beschneidung von Männern und von Frauen. Wir sitzen beim Abendessen, als Malkin zum ersten Mal über dieses, sein Herzensthema berichtet. Das Dinner findet, anders als ursprünglich geplant, nicht in einem schicken Gourmet-Restaurant statt, sondern in einem Yuppie-Restaurant im Herzen von Moskau. Malkin war beim Arzt, danach hat er beschlossen, dass er keine Lust darauf hat, stundenlang an einem Tisch zu sitzen und auf den siebten Gang zu warten. Er mag fine dining nicht besonders, er empfindet das als Zeitverschwendung. Also geht es in einen pseudoorientalischen Grill, Malkin bestellt sich Lamm und trinkt Rioja.
Malkins Beschäftigung mit Beschneidung begann auf einer Ägyptenreise 2009, als ihm sein Reiseführer erklärte, dass viele der auf Malkin so modern wirkenden Frauen in Ägypten beschnitten seien. Malkin, der, ich glaube, man darf das sagen, vielleicht auch einfach ein besonders zärtliches Verhältnis zu diesem Teil der weiblichen Anatomie hat, war schockiert. Er wusste zuvor nicht, dass es diese Praxis überhaupt gibt, oder zumindest nicht, dass sie so weit verbreitet ist. 2014 gründete er seine Fondation Espoir, eine Stiftung, die gegen die Verstümmelung von Frauen in Äthiopien kämpft.
Malkin zeigt mir auf seinem iPad Fotos vom Resultat einer Prozedur, die sich „Infibulation“ nennt und der in dem Teil Äthiopiens, in dem seine Stiftung arbeitet, praktisch jedes Mädchen unterzogen wird. Die Bilder sind unerträglich, die ganze Prozedur ist eigentlich unvorstellbar, es ist eine entsetzliche Zerstörung des weiblichen Geschlechtsorgans. Vielleicht ist Beschneidung die Kulturtechnik, in der am eindrücklichsten wird, wie religiöse Überzeugungen den Menschen deformieren können, aus Frauen Krüppel, aus Männern Monster machen. Unterdessen, da bleibt Malkin dann doch auch sehr er selbst, hält er die Beschneidung von Männern für kaum weniger schlimm als die von Frauen. Er will eine medizinische Studie in Auftrag geben, in der untersucht werden soll, ob Männer ohne Vorhaut weniger lustempfänglich sind als Männer mit Vorhaut.
Fünf Millionen Euro hat Malkin bereits in die Stiftung gesteckt, es soll noch mehr Geld werden, er will Mitstreiter werben demnächst. Wenn er über dieses Thema spricht, kocht eine leise Wut in ihm, dann kommt ein leises Zittern in seine Stimme. Er verachtet diese Sache. Er hasst sie.
Es ist dies unterdessen kein Thema, bei dem sich gut essen lässt, es wird also eher getrunken und dann irgendwann ein bisschen erschüttert geschwiegen, bevor ich Malkin wieder ein paar Fragen zum Thema Reichtum stelle: Was ist Luxus? Keine Ahnung, sagt Malkin, und dann: Vielleicht, wenn man dafür bezahlen kann, dass das eigene Buch in fünf Sprachen gleichzeitig erscheint. Macht Geld glücklich? Eher nein, sagt Malkin. Die meisten reichen Menschen, die er kenne, seien schrecklich angespannt, schrecklich nervös, furchtbar gestresst, dächten die ganze Zeit nur über Geld nach. Malkin wirkt auf einmal sehr weich, ein bisschen angeschlagen fast. Sind Sie einsam, Herr Malkin? „Ja“, sagt Malkin, „schon. Manchmal fühle ich mich sehr einsam.“ Gibt es denn niemanden, der schon immer da war, alte Freunde, Leute, die den echten Vitaly kennen? „Sehr viele der alten Freunde haben irgendwann um Geld gebeten“, sagt Malkin. „Manchen habe ich welches gegeben. Das ist eine traurige Geschichte. Ich habe eigentlich“, sagt er dann, „niemanden, mit dem ich wirklich richtig reden kann. Ich fühle mich manchmal depressiv.“
„Du, depressiv?“, sagt Nastya, die diesen Teil des Gesprächs überhört hat. „Niemals!“ – „Aber ich fühle mich manchmal depressiv.“ – „Du bist nicht depressiv, du bist höchstens traurig!“ – „Wirklich?“ – „Na klar, depressiv heißt, dass du überhaupt nichts mehr willst!“ – „Ah“, macht Malkin. „Dann also prost.“
Am nächsten Morgen stehen wir sehr früh auf und fahren alle zum Flughafen. Die Reise geht nach Monaco, Malkins Lebensmittelpunkt seit etwa vier Jahren, seine Freundin, sagt Malkin, habe dort leben wollen. Im Auto liest er lustlos Zeitungen, telefoniert. Er hat keine entgangenen Anrufe auf dem Telefon, aber über hundert Nachrichten in einer WhatsApp-Gruppe von Geschäftsleuten, die sich blöde Videos und Witze und Bilder von nackten Frauen schicken. Er telefoniert mit einer Assistentin in Luxemburg und überlegt, wo er nach Monaco hinsoll. Wandern in Andorra, in den Dolomiten vielleicht? Er hat nichts vor, er ist frei, er kann es sich leisten, er gehört nirgends hin.
Wir fliegen Holzklasse. Seine Privatflugzeuge hat Malkin alle verkauft, als der Markt für diese Art von Besitz vor einer Weile zusammenbrach, so ein Flieger sei auch wirklich nicht mehr nötig, sagt Malkin, wobei die kleinen Jets viele Vorteile hätten, sie flögen zum Beispiel so niedrig, dass man keine Thrombose zu befürchten habe, und der Blick aus dem Fenster sei besser. Malkin ist, das sagen auch seine Angestellten, keiner, der sein Geld verprasst oder gleichgültig wäre seinem Vermögen gegenüber.
Malkin behauptet, er fliege oft Economy, allerdings müssen seine Diener für ihn die Koffer abgeben, da bleibt er in seinem Mercedes-SUV sitzen, solange die in der Schlange stehen, und später behauptet Malkin, dass die Plätze doch irgendwie enger seien als sonst, was Quatsch ist. Tatsächlich gibt es im Flieger einfach keine Business- oder First-Class-Plätze.
In der Hitze von Nizza wartet ein gekühlter Maybach mit weißen Ledersitzen, surrendem Verdeck, kalten Wasserflaschen, Malkins Privatfahrzeug. Viel besser als ein Rolls, sagt er, und viel günstiger. Wir gleiten über die Autoroute nach Monaco. Überall verrückte Karren, Ferraris im Schritttempo. Malkin hat hier eine 600 Quadratmeter große Wohnung gemietet, niemand kauft in Monaco, sagt er. Sein Wohnturm hat ein eigenes Spa und eine große Tiefgarage, in der Malkins Fuhrpark steht, der Maybach, ein Ferrari, den nur seine älteren Söhne fahren, Malkin selbst fährt in Monaco am liebsten seinen Renault Twizy, ein kleines Einsitzer-Elektroauto.
Die Wohnung ist voller metallener Säulen und versteckter Leuchten und spiegelnder Oberflächen. Es liegen ein paar ausgestopfte Krokodile herum, ein nackter Frauentorso aus Glas ziert einen Tisch, es gibt weite, offenbar ungenutzte Sitzlandschaften, einen Flügel, eine Fotowand mit professionell aufgenommenen Familienporträts. Malkin führt sein Gym vor, die drei riesigen, mit Spielzeug vollgestopften Kinderzimmer mit Blick über Monaco und jeweils eigenem Wannenbad, die winzigen Kammern der Nannies, das Heimkino, das Esszimmer, in dem die Familie die meiste Zeit verbringt und in dem es, ausnahmsweise einmal, menschlich, unaufgeräumt, lebendig aussieht. Malkin findet vieles an der Wohnung Quatsch und manches schade. Wir nutzen nie diesen tollen Balkon, sagt er, wir sitzen nie in dem Wohnzimmer, das ist alles nur Unsinn. Dann klatscht er auf einmal in die Hände, ihm fällt etwas ein, und er lässt, bessere Laune nun, die Icaros-Maschine aufbauen.
Mittags hat Malkin eine Signierstunde im Fnac, einem gesichtslosen Medien-Shop in einer Shoppingmall, der neben den neuesten Playstation-Spielen auch ein paar Bücher führt. Da ist ein Pult aufgebaut mit Malkins Buch, die französische Ausgabe hat eine kleine Binde mit einem lobenden Zitat darauf von dem französischen Intellektuellen Frédéric Beigbeder. Malkin und Beigbeder sind miteinander gut bekannt, angeblich ist Malkin sogar das reale Vorbild für eine Figur in Beigbeders Roman Au secours pardon.
Im Fnac ist es bedrückend, Malkin steht neben dem Signierpult, es erscheinen vielleicht vier, fünf Leute, die eine Unterschrift wünschen. Das übrige Publikum sind fünf puppenhafte Frauen, Freundinnen seiner Freundin. Malkin schwitzt und sucht die Nähe seiner Entourage, erzählt den Frauen einen albernen Witz. Sein Diener blättert in Kinderbüchern.
Nachmittags rennen wir durch den Kaktusgarten von Monaco, den Malkin unbedingt zeigen wollte, er wirkt wie getrieben. Was für tolle Kakteen, diese hier zum Beispiel oder diese, sagt Malkin, ohne stehen zu bleiben. Irgendwas stimmt nicht. Wir fahren weiter nach Èze, einem mittelalterlichen Dorf an der Côte d’Azur, Malkin bleibt am längsten auf dem Friedhof.
Dass etwas von ihm bleibe, hat er mir in Moskau noch gesagt, das wünsche er sich. Nicht sein Name, der sei gleichgültig, und tatsächlich wollte er seine Bücher anfangs anonym veröffentlichen, aber alle Verleger meinten, wenn wir sagen, wer du bist, wird es mehr Leute interessieren. Bestimmt richtig. Aber ein Erbe hinterlassen jenseits des Geldes, das wünscht sich Malkin. Mit seiner Stiftung, mit seinen Gedanken. Ein bisschen die Welt besser machen, jetzt, wo die großen Rennen gelaufen sind, vielleicht noch auf eine ganz andere Art etwas bewegen?
Abends lädt Vitaly Malkin den Verleger, Nastya, eine weitere Assistentin und mich in ein neues Ceviche-Restaurant an der Bucht von Monaco ein. Der Laden ist riesig, loungig, clubbig, die Männer tragen alle Jackett, die Frauen alle Cocktailkleider, die Frauen sehen auch alle ganz unglaublich aus, wie Menschen, die den Tag bloß in Gym, Boutique und Salon verbringen. Ich sehe Angela Ermakowa, Boris Beckers Besenkammerbekanntschaft, sowie deren gemeinsame Tochter durch den Laden laufen, an solchen Orten trifft man solche Leute. Als es ein Feuerwerk über dem Hafen gibt, filmen alle mit ihren Handys, Wahnsinn, Feuerwerk.
Malkin sitzt und trinkt Rotwein, genießt das Ceviche, redet über seine Projekte, redet über Frauen, über Trieb, Beischlaf, Liebe. Liebe sei das Größte. Dann komme Macht. Dann komme Denken. Das seien die besten Dinge. Aber die Liebe bleibe nicht, sagt er. Und Macht, denke ich, hat er kaum noch. Ich weiß nicht, wie bewusst ihm in solchen Momenten wird, dass er da im Grunde über das Verschwinden der schönsten Dinge aus seinem Leben spricht. Er wirkt in diesem Moment jedenfalls nicht bedrückt deswegen.
Nach dem Dinner treten wir vor die Türe und werden Zeugen einer grandiosen Performance. Gleich neben dem Restaurant liegt das Jimmy’z, Monte Carlos größter, wichtigster Club. Es ist etwa 23 Uhr, Samstagabend, und man fährt vor. Da steht eine lange Schlange von Lamborghinis, Porsches, Rolls-Royce, Ferraris, und immer steigt auf der Fahrerseite ein Mann beliebigen Alters aus und auf der Beifahrerseite eine sehr junge Frau oder manchmal auch zwei oder drei Frauen, und die Frauen sind wirklich sehr zurechtgemacht, und keine ist dick. Es ist hypnotisch. Malkin möchte nun, dass wir ins Jimmy’z gehen. Er geht zum Türsteher, redet ein paar Sekunden mit ihm, und dann werden wir, hässlich, arm, underdressed, gnädig reingewinkt.
Was willst du trinken, fragt mich Malkin, der nun wieder sehr aufgeräumt, fröhlich wirkt. Bier?, frage ich, weil ich Lust habe auf ein Bier. Malkin schüttelt unwillig den Kopf. Komm schon, Mann, lass uns ein bisschen Geld ausgeben, sagt er. Wir bestellen Champagner.
Vitaly Malkin steht im Jimmy’z, ein Glas Champagner in der Hand, umgeben von schönen jungen Frauen, die Musik ist laut, die Nacht ist lau. Kennst du, fragt er über den Lärm des Geredes und der Bässe hinweg, die Geschichte von Eulenspiegels Beutelchen? Als Eulenspiegel ein Kind war, wurde vor ihm sein Vater auf dem Scheiterhaufen verbrannt wegen Ketzerei. Der kleine Eulenspiegel ist danach zu dem Haufen Glut und Asche gegangen und hat ein Beutelchen mit Asche gefüllt und sich um den Hals gehängt. Später, als er schon ein Mann ist, fragt jemand den Eulenspiegel: Warum regst du dich so auf, warum kämpfst du so, warum lässt du niemanden in Ruhe? Und Eulenspiegel antwortet: Die Asche in meinem Beutelchen ist immer noch heiß, und sie brennt auf meinem Herzen. So, sagt Vitaly Malkin, geht es mir, wenn ich an die Beschneidung der jungen Frauen denke.
Für einen Moment sieht er furchtbar zornig aus. Dann stürzt er sein Glas Champagner hinunter und geht tanzen. Irgendwann in den nächsten Tagen will er in die Dolomiten reisen oder nach Andorra oder an den Gardasee oder in die Türkei oder nach Mauretanien.